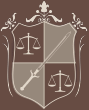Kinder enterben (mit & ohne Pflichtteil) – 2 Varianten im Überblick
Es kann verschiedene Gründe haben, warum die eigenen Kinder aus dem Erbe entnommen werden sollen. Welche Möglichkeiten Ihnen diesbezüglich zur Verfügung stehen, erfahren Sie hier.
Das Erbrecht bietet jedem Bürger die Möglichkeit, frei zu entscheiden, was mit seinem Vermögen im Falle des eigenen Ablebens geschehen soll. So lässt sich die gesetzliche Erbfolge durch Verfügungen von Todeswegen, also zum Beispiel Testamente, an die eigenen Wünsche und Vorstellungen anpassen. In diesem Rahmen können auch bestimmte Personen vollständig von der Erbfolge ausgeschlossen werden. Dieses Vorgehen wird als Enterbung bezeichnet.

Kinder aus dem eigenen Erbe streichen zu lassen ist meist keine leichte Entscheidung.
Die Gründe, aus denen sich jemand dazu entschließt, seine Kinder zu enterben, können ganz unterschiedlich sein. Neben Konflikten innerhalb der Familie können auch vorangegangene Schenkungen ein Grund dafür sein, dass Eltern Ihre Kinder enterben. Entsprechende Formulierungen machen aber nur dann Sinn, wenn das Kind gesetzlich einen Anspruch auf das Erbe hat.
| Gesetzlicher Erbanspruch | Kein gesetzlicher Erbanspruch |
|
|
|
|
| |
|
Die gesetzlichen Vorgaben für eine Enterbung ergeben sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). So heißt es in § 1938 BGB „Der Erblasser kann durch Testament einen Verwandten, den Ehegatten oder den Lebenspartner von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen, ohne einen Erben einzusetzen.“ Daraus geht hervor, dass zum Enterben der Kinder ein Testament notwendig ist. Per Definition handelt es sich bei Testamenten um Schriftstücke, durch die der Verfasser Regelungen für den Erbfall treffen kann. Enterbungen sind in diesem Zusammenhang sowohl bei notariell beglaubigten als auch bei handschriftlichen Testamenten gültig. Soll eine Enterbung Teil des Testamentes sein, sollten Sie sich mit diesem Anliegen aber dennoch an einen Notar wenden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Verfügung rechtssicher und schwer anzufechten ist.
Das Berliner Testament
Die Enterbung von Kindern ist lange keine Seltenheit mehr. Der Grund für eine Enterbung ist dabei aber keineswegs immer ein Konflikt zwischen den Generationen. Im Rahmen des Berliner Testaments setzen sich Ehegatten häufig gegenseitig als Alleinerben ein und übergehen so vorerst die Kinder. Der Grundgedanke ist hier die Absicherung des länger lebenden Ehegatten. Das ist beispielsweise bei gemeinsam genutzten Immobilien wichtig, die unter Umständen verkauft werden müssten, um den Kindern ihren Pflichtteil auszuzahlen. Im Rahmen des Berliner Testaments ist es jedoch nicht möglich, die Kinder vollständig zu enterben. Sie werden meist als Schlusserben eingesetzt und haben mindestens einen Anspruch auf den Pflichtteil.

Mit dem Berliner Testament können die Kinder nicht vollständig enterbt werden.
Der Pflichtteil
Grundsätzlich hängt der Pflichtteil von der Höhe des dem Erben gesetzlich zustehenden Erbteils ab. Dabei bestimmt die gesetzliche Erbfolge, welchem Nachkommen wie viel vom Erbe zusteht, sofern der Erblasser keine entsprechenden Bestimmungen im Testament getroffen hat. Gemäß § 2303 BGB besteht der Pflichtteil „in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.“ Leibliche und adoptierte Kinder erben regelmäßig zu gleichen Teilen. Ist der Erblasser beispielsweise nicht verheiratet und hat zwei Kinder, erben beide Kinder jeweils die Hälfte des Nachlasses. Will er dagegen nur eines der beiden Kinder beerben, erhält das enterbte Kind dennoch seinen Pflichtteil. Dieser muss also noch vom Nachlass abgezogen werden. Das bedeutet, dass das enterbte Kind ein Viertel der Erbschaft verlangen kann, obwohl es per Testament von der Erbfolge ausgeschlossen wurde. Komplizierter gestaltet sich das Beispiel, wenn der Erblasser verheiratet war. Ehegatten haben je nach dem in der Ehegemeinschaft bestehendem Güterstand andere gesetzliche Ansprüche an den Erbteil, die sich auch auf den Anteil der Kinder auswirken können.

Der Pflichtteil eines Erbens kann nur unter besonderen Umständen vollständig verfallen.
Enterben ohne Pflichtteil
Der Pflichtteilsanspruch kann nur schwer vollkommen aufgehoben werden. Für ein solches Verwirken der Ansprüche müssen seltene Ausnahmefälle gegeben sein. So muss der Erblasser zum Beispiel Gründe vortragen können, die die Pflichtteilsberechtigung des gesetzlich Erbberechtigten aufheben. Die Erteilung des Nachlasses an den Erbberechtigten muss dem Erblasser dabei grundlegend unzumutbar sein.
Ein Pflichtteilsentzug ist unter folgenden Ausnahmefällen möglich (§2333 BGB):
- Der Erbberechtigte trachtet dem Erblasser oder einer ihm nahstehenden Person nach dem Leben
- Der Erbberechtigte macht sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegenüber dem Erblasser oder einer ihm nachstehenden Position schuldig
- Der Erbberechtigte verletzt seine gesetzlich geregelte Unterhaltspflicht gegenüber dem Erblasser
- Der Erbberechtigte wurde wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung verurteilt
Ist jeglicher Kontakt zur Familie abgebrochen, kann diese Situation ebenfalls die Enterbung der Kinder rechtfertigen. Laut Gesetz reicht dies aber nicht aus, damit der Pflichtteilsanspruch verfällt. Des Weiteren erlischt das Recht zur Entziehung des Pflichtteils durch eine Verzeihung besagter Ausnahmefälle. Die Folge ist das Unwirksamwerden der im Testament enthaltenen Enterbung samt Pflichtteil.
Den genauen Unterschied zwischen Enterben und dem Pflichtteil, erfahren Sie in folgendem Youtube-Video:
Pflichtteilsverzicht & Erbverzicht
Der Erbberechtigten gesetzlich zustehende Pflichtteil kann aber auch durch Pflichtteils- oder Erbverzicht umgangen werden. Verzicht bedeutet dabei nicht unbedingt, dass man leer ausgeht. So gehen Pflichtteils- und Erbverzicht häufig mit einer Gegenleistung einher. Auf der anderen Seite hat ein solcher Verzicht natürlich auch Konsequenzen. In jedem Fall ist es wichtig, zwischen Pflichtteilsverzicht und Erbverzicht zu unterscheiden. So bedeutet der Verzicht auf den Pflichtteil lediglich, dass man den Anspruch auf den gesetzlichen Pflichtteil abgibt. Von dieser Entscheidung sind, sofern nicht anders vereinbart, allerdings nicht nur die verzichtenden Personen, sondern auch deren übrige Nachfahren betroffen. Ein Verzicht auf den Pflichtteil bedeutet aber nicht, dass gar nichts vererbt wird. Es ist nach wie vor möglich, als Erbe im Testament aufgeführt zu werden. Der Erbverzicht geht im Vergleich deutlich weiter. Hier tritt der Erbberechtigte seine Ansprüche vollständig ab. Diese Vereinbarung umfasst auch den Pflichtteil. Im Erbverzicht ist der Pflichtteilsverzicht also immer automatisch enthalten. Für beide Wege ist ein schriftlicher Vertrag zwischen Erblasser und den verzichtenden Erben unabdingbar. Darüber hinaus muss die Vereinbarung von einem Notar beurkundet und noch vor dem Ableben des Erblassers vereinbart werden. Über die Konsequenzen eines solchen Verzichts sollte man sich im Vorfeld unbedingt Gedanken machen. Er ist unter anderem dann sinnvoll, wenn eine Person bereits zu Lebzeiten unterstützt oder das Einfordern des Pflichtteils verhindert werden soll. Darüber hinaus empfiehlt sich ein Erbverzicht, wenn als Gegenleistung der Familienbetrieb übertragen und damit der Fortbestand der Unternehmung sichergestellt wird. In diesem Fall wird durch den Erbverzicht verhindert, dass die Firma verkauft oder aufgeteilt werden muss, um die Pflichtteilsansprüche der Erben zu begleichen. Allerdings können solche Vereinbarungen zum Erb- und Pflichtteilsverzicht zu Lebzeiten des Erblassers angefochten werden.
Noch offene Fragen? Wir helfen gerne!
Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Enterben haben oder sich persönlich und kompetent beraten lassen möchten, sind wir gerne für Sie da. Mit Fachwissen, langjähriger Erfahrung und kostenbewussten Strukturen setzen wir uns gerne für Sie ein. Vertrauen Sie unserer modernen und erfolgsorientierten Fachanwaltskanzlei und profitieren Sie von einer Zusammenarbeit mit uns. Lassen Sie sich bei Fragen rund um die Ausschlagung eines Nachlasses von unserem Fachanwalt für Erbrecht Dr. Robert Beier, LL.M. unter 06151/130230 beraten.
Häufige Fragen (FAQ)


Der Pflichtteilsanspruch kann nur schwer vollkommen aufgehoben werden. Für ein solches Verwirken der Ansprüche müssen seltene Ausnahmefälle gegeben sein. So muss der Erblasser zum Beispiel Gründe vortragen können, die die Pflichtteilsberechtigung des gesetzlich Erbberechtigten aufheben. Die Erteilung des Nachlasses an den Erbberechtigten muss dem Erblasser dabei grundlegend unzumutbar sein.
Ein Pflichtteilsentzug ist unter folgenden Ausnahmefällen möglich (§2333 BGB):
Der Erbberechtigte trachtet dem Erblasser oder einer ihm nahstehenden Person nach dem Leben
Der Erbberechtigte macht sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegenüber dem Erblasser oder einer ihm nachstehenden Position schuldig
Der Erbberechtigte verletzt seine gesetzlich geregelte Unterhaltspflicht gegenüber dem Erblasser
Der Erbberechtigte wurde wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung verurteilt


Der Erbverzicht geht im Vergleich zum Pflichtteilverzicht deutlich weiter. Hier tritt der Erbberechtigte seine Ansprüche vollständig ab. Im Erbverzicht ist der Pflichtteilsverzicht also immer automatisch enthalten. Für beide Wege ist ein schriftlicher Vertrag zwischen Erblasser und den verzichtenden Erben unabdingbar. Darüber hinaus muss die Vereinbarung von einem Notar beurkundet und noch vor dem Ableben des Erblassers vereinbart werden.


Das Pflichtteilsrecht ergibt sich aus der gesetzlichen Erbfolge. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, wobei nicht jeder nach dem Gesetz berufene Erbe auch pflichtteilsberechtigt ist.






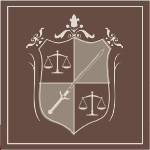





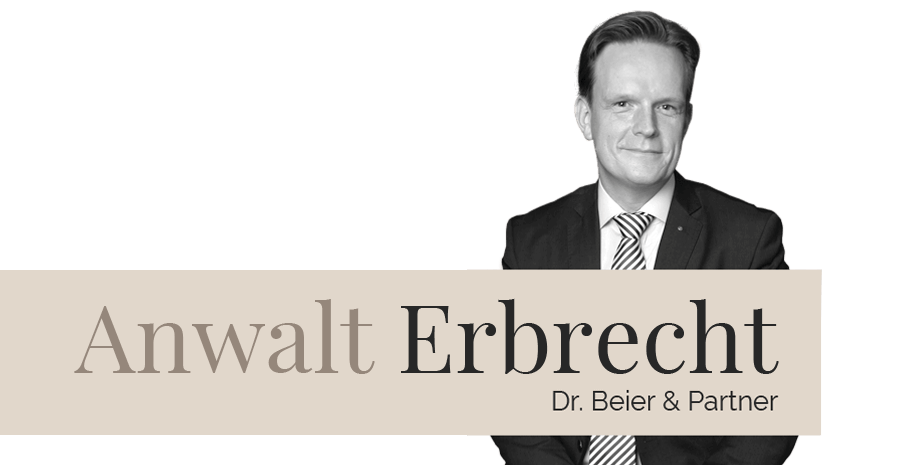

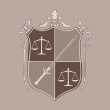


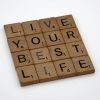
 ❯
❯